Ob Chatbots, selbstfahrende Autos oder personalisierte Empfehlungen: Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unseres Alltags, oft ohne dass wir es merken. Doch was ist künstliche Intelligenz eigentlich genau?
Der Begriff beschreibt Technologien, die menschenähnliche Fähigkeiten wie Denken, Lernen oder Problemlösen nachahmen. Und das Thema gewinnt rasant an Bedeutung: Laut Prognosen wird die Nutzerzahl zwischen 2025 und 2031 weltweit um rund 826 Millionen steigen. Das ergibt ein Plus von über 238 %. Bis 2031 soll die Zahl der User einen neuen Höchststand erreichen und auf rund 1,2 Milliarden anwachsen.
In diesem Artikel erfahrt ihr, was künstliche Intelligenz ist und welche Chancen und Risiken sie für Unternehmen und unsere Gesellschaft mit sich bringt.
Was ist künstliche Intelligenz: Das Wichtigste in Kürze
Künstliche Intelligenz simuliert menschliche Intelligenz durch maschinelles Lernen und Kreativität, um selbstständig Probleme zu lösen und neue Ideen zu generieren. Die KI-VO reguliert den KI-Einsatz nach Risikostufen, fördert Innovation und Grundrechte und fordert eine transparente, ethische Anwendung von KI-Systemen. Unternehmen müssen KI-Kompetenz schulen, um KI zielgerichtet und innerhalb des rechtlichen Rahmens einzusetzen.
Was ist künstliche Intelligenz?
Künstliche Intelligenz bezeichnet die Fähigkeit von Maschinen oder Computern, Aufgaben zu übernehmen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Sie kann dabei eine Reihe kognitiver Fähigkeiten nachahmen:
- Logisches Denken und Problemlösung
- Sprachverständnis und -verarbeitung
- Visuelle Wahrnehmung und Bilderkennung
- Lernfähigkeit und Anpassung an neue Situationen
KI-Systeme arbeiten mit großen Datenmengen und komplexen Algorithmen. Sie analysieren Informationen, erkennen Zusammenhänge und treffen auf dieser Basis Aussagen oder Entscheidungen.
Zwei besonders zentrale Aspekte dafür sind:
Das maschinelle Lernen
Beim maschinellen Lernen verbessern Algorithmen ihre Leistung durch Erfahrung, ähnlich wie Menschen, die aus Fehlern lernen.
Die Fähigkeit zur Kreativität
Die kreative Komponente zeigt sich in der Fähigkeit von KI-Systemen, neue Ideen zu generieren, etwa in Form von Texten, Bildern oder auch Musikstücken.
Die Geschichte der KI
Die Geschichte der künstlichen Intelligenz reicht weiter in die Vergangenheit zurück, als viele vermuten. Schon in den 1950er Jahren entwickelte Alan Turing einen Test, der die grundlegende Frage aufwirft: Wann können wir eine Maschine als intelligent bezeichnen?
Der Turing-Test
Beim Turing-Test kommuniziert ein Mensch schriftlich mit einem Computer und einem anderen Menschen, ohne zu wissen, wer was ist. Kann die prüfende Person nach mehreren Gesprächen nicht zuverlässig unterscheiden, ob sie mit Mensch oder Maschine kommuniziert, gilt der Test als bestanden. Der Test ist zwar umstritten, da er das Sprachvermögen der Maschine mit deren Denkfähigkeit gleichsetzt, trotzdem gilt er als Meilenstein der Forschung.
Das Perzeptron
Das Perzeptron, 1958 von Frank Rosenblatt entwickelt, gilt als Vorläufer heutiger neuronaler Netze. Es handelt sich um ein einfaches künstliches Neuron, das Eingangssignale gewichtet, summiert und bei Überschreiten eines Schwellenwerts ein Ausgangssignal erzeugt. Auch wenn das Perzeptron zunächst nur einfache Aufgaben lösen konnte, hat es den Grundstein für komplexere Modelle des maschinellen Lernens gelegt.
Der erste Chatbot: ELIZA
1966 entwickelte Joseph Weizenbaum am MIT das Programm ELIZA, das als erster Chatbot der Geschichte gilt. Obwohl ELIZA relativ einfach aufgebaut war und kein echtes Sprachverständnis besaß, gelang es dem Programm oft, Menschen von einer scheinbar intelligenten Konversation zu überzeugen.
Grundlagen der künstlichen Intelligenz: Wie funktioniert KI?
Bei der Funktionsweise gibt es in erster Linie die folgenden vier Grundsätze:
- Machine Learning
- Deep Learning
- Supervised Learning
- Unsupervised Learning
Machine Learning
Beim Machine Learning lernen Algorithmen aus Daten und Erfahrungen. Das bedeutet konkret: Algorithmen verbessern sich durch wiederholte Aufgabenerfüllung; künstliche Intelligenz identifiziert eigenständig Zusammenhänge und Muster in Datensätzen; und statt detaillierter Schritt-für-Schritt-Anweisungen erhält die KI die Vorgabe des „Was“, nicht des „Wie“, und findet selbst geeignete Lösungswege.
Deep Learning
Deep Learning ist eine fortgeschrittene Form des Machine Learning. Sie basiert auf künstlichen neuronalen Netzen, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind. Mehrere Ebenen von Datenknoten verarbeiten Informationen, das Design orientiert sich an den Verbindungen der Nervenzellen, und die ständige Verarbeitung neuer Daten verbessert die Leistung.
Supervised Learning
Beim Supervised Learning trainieren Entwickler:innen KI-Modelle mit vorklassifizierten Daten; jede Eingabe entspricht einer bekannten, korrekten Ausgabe (Label). Das Modell lernt anhand gelabelter Datensätze, erkennt Muster zwischen Ein- und Ausgaben und nutzt diese Erkenntnisse, um neue, unbekannte Daten korrekt zu klassifizieren. Typische Einsatzgebiete sind die Bilderkennung, die Betrugsprävention und die Sprachverarbeitung.
Unsupervised Learning
Beim Unsupervised Learning arbeiten KI-Modelle mit ungelabelten Daten und entdecken selbstständig Muster und Strukturen. Die Systeme gruppieren Daten ohne vorgegebene Kategorien, erkennen Zusammenhänge und Anomalien und sind besonders anpassungsfähig bei unbekannten oder sich ändernden Datensätzen. Einsatzgebiete finden sich etwa im Marketing (Segmentierung), in der Cybersecurity (Erkennen ungewöhnlicher Aktivitäten) und in der Textanalyse (Clustering ähnlicher Dokumente).
Arten von künstlicher Intelligenz
Schwache vs. starke KI
Schwache KI, auch „narrow AI“ genannt, ist auf spezifische Aufgaben spezialisiert. Sie treibt heute viele praktische Anwendungen wie Sprachassistenten, Schachcomputer oder Empfehlungssysteme an und ist derzeit die vorherrschende Form der künstlichen Intelligenz. Starke KI, oft als „Artificial General Intelligence“ (AGI) bezeichnet, zielt auf menschenähnliche kognitive Fähigkeiten: Sie soll selbstständig denken, lernen und Probleme in verschiedensten Kontexten lösen können. AGI existiert bislang nur theoretisch und nicht in der Praxis.
Symbolische vs. subsymbolische KI
Symbolische KI basiert auf logischen Regeln und Symbolen, arbeitet mit explizitem Wissen und ermöglicht nachvollziehbare Entscheidungswege; ein klassisches Beispiel sind Expertensysteme in der Medizin. Subsymbolische KI nutzt hingegen mathematische Modelle und statistische Methoden, lernt aus Daten ohne explizite Regeln und ist in ihren Entscheidungen oft schwerer zu interpretieren; typische Beispiele sind neuronale Netze in der Bilderkennung.
Software- vs. eingebettete KI
Software-KI läuft auf Standard-Computersystemen, ist flexibel einsetzbar und lässt sich leicht aktualisieren. Beispiele sind Chatbots oder Empfehlungssysteme in Online-Shops; der Vorteil liegt in der schnellen Anpassung an neue Anforderungen. Eingebettete KI ist direkt in Hardware integriert, für spezifische Aufgaben und Umgebungen optimiert und findet sich etwa in Smartwatches, autonomen Fahrzeugen oder intelligenten Haushaltsgeräten. Ihr Vorteil ist die Effizienz und Echtzeitverarbeitung vor Ort.
Was ist Generative KI?
Generative KI erstellt eigenständig neue Inhalte, die zuvor nur Menschen durch ihre eigene Kreativität erschaffen konnten. Solche Modelle lernen aus großen Datenmengen die zugrunde liegenden Muster und Regeln und nutzen dieses Verständnis, um neue, originale Inhalte zu erzeugen, die den Trainingsdaten ähneln, aber nicht identisch sind.
Generative KI kann Texte verfassen – von kurzen Artikeln bis hin zu Gedichten –, Bilder aus Textbeschreibungen erstellen, neue Melodien und Musikarrangements komponieren, Programmcode entwickeln sowie Videos und animierte Szenen erzeugen.
Wozu wird künstliche Intelligenz verwendet?
Künstliche Intelligenz findet in zahlreichen Bereichen unseres Alltags Anwendung. Wichtige Einsatzgebiete sind digitale Assistenten wie Siri, Alexa oder ChatGPT; Verkehr und Navigation mit Routenoptimierung und autonomem Fahren; E-Commerce durch personalisierte Empfehlungen; Sprachverarbeitung für Übersetzungen und Spracherkennung; das Gesundheitswesen mit Früherkennung von Krankheiten und Analyse medizinischer Bilder; die Cybersicherheit zur Erkennung und Abwehr digitaler Bedrohungen; intelligentes Wohnen mit Steuerung von Heizung, Beleuchtung und Sicherheitssystemen; die Bildanalyse von Gesichtserkennung bis zur Aufdeckung von Deepfakes; sowie die Industrie mit Prozessoptimierung und Robotik.
Chancen und Risiken von KI
Künstliche Intelligenz verspricht, viele Bereiche unseres Lebens zu verbessern und zu vereinfachen, wirft aber zugleich ethische und gesellschaftliche Fragen auf. Für einen verantwortungsvollen Einsatz sollten beide Seiten betrachtet werden.
Chancen: KI automatisiert Prozesse und beschleunigt Abläufe in vielen Branchen. Personalisierte Angebote verbessern Kundenerlebnisse. Systeme unterstützen die Prävention und Früherkennung von Risiken, zum Beispiel in der Cybersecurity. Zudem treibt KI Innovationen in Wissenschaft und Technik voran.
Risiken: KI-Systeme können vorhandene Biases verstärken und zu Diskriminierung führen. Automatisierung kann bestimmte Berufsbilder verdrängen. Deepfakes und KI-generierte Inhalte erschweren die Unterscheidung von Fakten und Fiktion. Die Verarbeitung großer Datenmengen wirft Datenschutzfragen auf, und komplexe Systeme wirken oft als „Black Box“ und sind schwer nachzuvollziehen.
KI-Verordnung der EU: EU AI Act
Der EU AI Act regelt den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union. Die Verordnung stuft KI-Systeme nach ihrem Risiko ein – von inakzeptabel bis minimal. Für Hochrisiko-Anwendungen gelten strenge Kontrollen; zugleich müssen alle KI-Systeme ein Mindestmaß an Transparenz erfüllen. Ziele sind die Förderung von Innovation, der Schutz von Grundrechten sowie die Einhaltung ethischer Prinzipien. Unternehmen sind gefordert, Kompetenzen aufzubauen, damit Mitarbeitende KI sachgemäß einsetzen und jederzeit kontrollieren können.
Wie sieht künstliche Intelligenz in der Zukunft aus?
Die Entwicklung künstlicher Intelligenz schreitet rasant voran und wird Alltag wie Arbeitswelt nachhaltig prägen. KI-Systeme werden zunehmend unsichtbar integriert und allgegenwärtig sein – von intelligenten Haushaltsgeräten bis zu Anwendungen im Gesundheitswesen. Für Unternehmen wird KI zum zentralen Wettbewerbsfaktor: Sie eröffnet neue Spielräume, wo klassische Prozesse an Grenzen stoßen. Wer die Chancen nutzen will, sollte jetzt handeln; Investitionen in Technologien und Kompetenzen werden entscheidend für künftigen Erfolg.
Künstliche Intelligenz gezielt im Unternehmen einsetzen
Generell übernimmt KI repetitive Aufgaben schnell und präzise. Für nachhaltigen Erfolg im Unternehmen kommt es auf den richtigen Einsatz an: Identifiziert konkrete Bereiche mit echtem Mehrwert – nicht jedes Problem braucht eine KI-Lösung. Plant ausreichend Zeit für die Implementierung ein, denn Erfolge stellen sich oft verzögert ein. Berücksichtigt den EU AI Act von Beginn an in der KI-Strategie. Vor allem aber gilt: Gut geschulte Mitarbeitende sind der Schlüssel zum Erfolg mit KI.
Was ist künstliche Intelligenz: Fazit
Der Schlüssel zum erfolgreichen und verantwortungsvollen KI-Einsatz liegt in der Kompetenz. Unternehmen, die KI verstehen, bewerten und gezielt einsetzen können, werden künftig einen Vorsprung haben. Letztlich hängt der Erfolg im KI-Zeitalter nicht allein von der Technologie ab, sondern von den Menschen, die sie entwickeln, implementieren und nutzen. Es geht darum, KI als Werkzeug einzusetzen, um Mehrwert zu schaffen – stets im Einklang mit der rechtlichen Lage.
Mit ada AI Literacy könnt ihr die KI-Kompetenz eurer Mitarbeitenden gezielt stärken – mit Grundlagen gemäß EU AI Act, praxisorientierten Inhalten für verantwortungsvolle Nutzung, Unterstützung bei der Bewertung von Chancen und Risiken sowie Expertenwissen für die direkte Umsetzung. Direkt Termin vereinbaren
FAQ
Was besagt der EU AI Act?
Der EU AI Act ist eine umfassende Verordnung zur Regulierung künstlicher Intelligenz in der EU. Er kategorisiert KI-Systeme nach ihrem Risikograd und legt entsprechende Regeln fest. Außerdem fordert er Transparenz bei der Nutzung von KI.
Was ist Explainable AI?
Explainable AI (XAI) umfasst Methoden, die die Entscheidungsprozesse von KI-Systemen für Menschen verständlich machen. Ziel ist es, die „Black Box“ zu öffnen.
Was bedeutet Black Box bei KI?
Als „Black Box“ bezeichnet man ein System, dessen innere Entscheidungswege nicht transparent sind. Sichtbar sind Input und Output, nicht aber der Weg dazwischen.
Was sind Large Language Models?
Large Language Models (LLMs) sind KI-Modelle zur Verarbeitung und Generierung natürlicher Sprache. Sie werden mit sehr großen Textmengen trainiert und lösen Aufgaben wie Textgenerierung, Übersetzung oder Frage-Antwort. Bekannte Beispiele sind GPT und BERT.
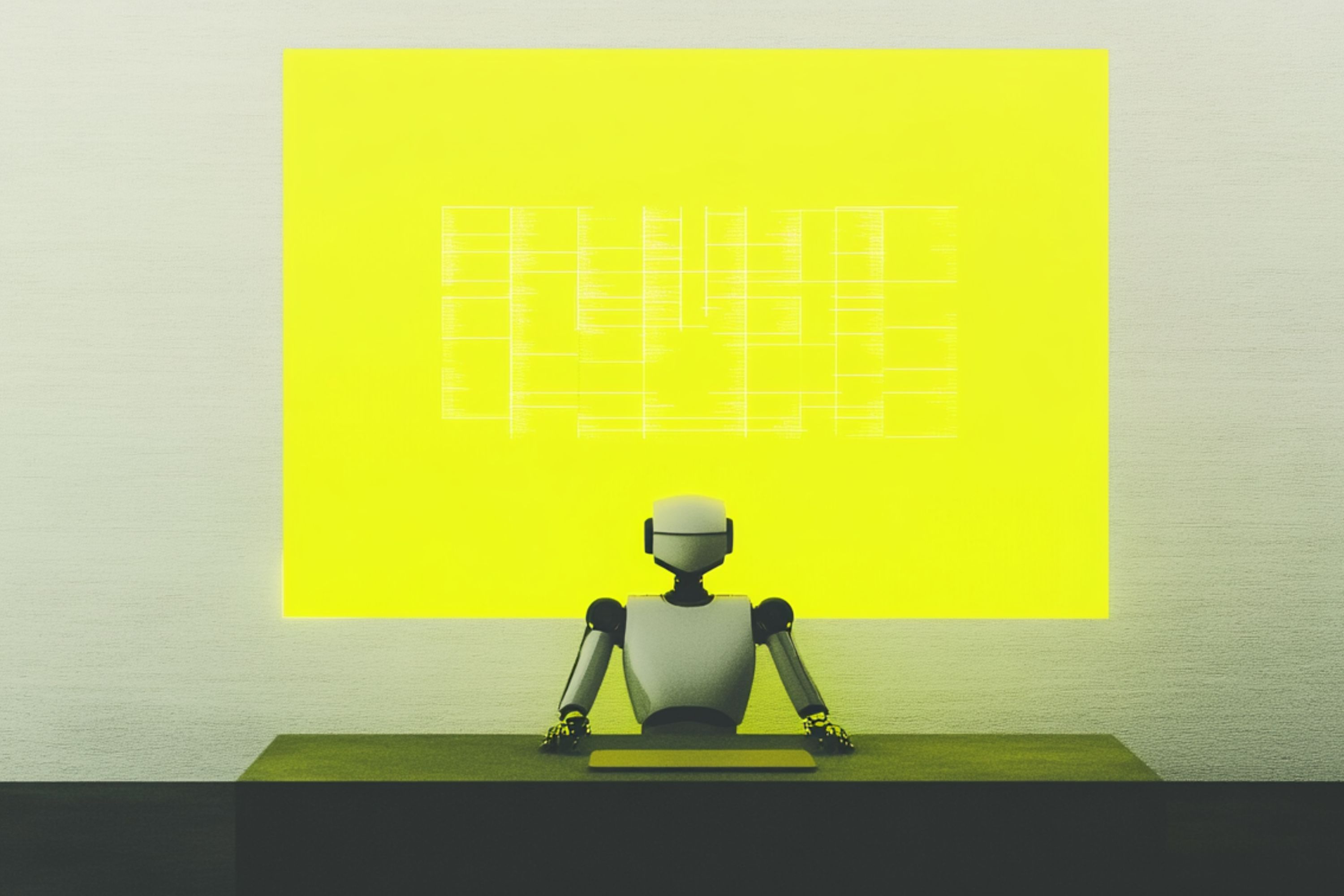
.png)

